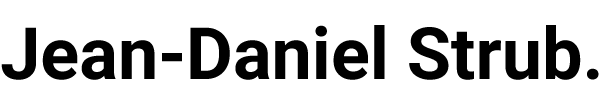Digitale Rundumreform für Zürich
Die Stadt will digitale Technologien nutzen, um besser und effizienter mit ihren Bewohnern zu kommunizieren. Um eine echte «Smart City» zu werden, müsse Zürich aber noch viel weiter gehen, fordert ein Experte.
Von André Müller und Daniel Fritzsche
Wer von der Stadt Zürich Tipps zum Energiesparen sucht, wird online an vielen Orten fündig – wenn er sich Zeit nimmt. Zum Beispiel kann er sich beim Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) für ein Energie-Coaching anmelden. Energiespartipps gibt aber auch das EWZ, das zum Departement der Industriellen Betriebe gehört, aber seine eigene Seite führt. Die GUD-Unterseite verweist zwar auf das EWZ. Dahinter verbirgt sich aber ein Error 404 – ein toter Link.
Solches Flickwerk soll bald der Vergangenheit angehören. Seit Anfang Jahr werkelt die Stadt Zürich an ihrem digitalen Schalter namens «Mein Konto», über den die Zürcherinnen und Zürcher an einem Ort künftig (fast) alle Informationen der Stadt erhalten und ihre Behördenkontakte abwickeln können. Diese E-Government-Plattform ist aber nicht genug: Bis Ende 2018 entwirft Zürich eine Smart-City-Strategie, die deutlich weiter gehen soll. Details sind noch nicht viele bekannt, auf der Website sind vor allem die vier Grundsätze aufgeführt, an welchen sich die Stadt orientieren will. Sie sind stark an die Tallinn-Deklaration von 2017 angelehnt, in der sich die europäischen Länder zu den wichtigsten Prinzipien fürs Regieren mit digitalen Mitteln bekennen.
Alte Departemente, neue Möglichkeiten
Für Maximilian Stern vom politischen Think-Tank Staatslabor ist «Mein Konto» ein guter und gut gemachter Anfang: «Die Nutzer interessiert es nicht, ob der Service jetzt vom Departement X oder Y kommt. Sie wollen sich schnell anmelden und ihr Anliegen rasch erledigt haben.» Doch um eine eigentliche Smart City zu werden, müsse die Stadt weitergehen. «‹Mein Konto› ist erst der Schalter – jetzt muss im Hintergrund auch die Organisation entsprechend angepasst werden.» Der Politologe beschäftigt sich schon länger mit der Frage, wie der Staat neue Technologien sinnvoll nutzen kann, und hat letzthin mit dem Campaigner Daniel Graf ein Buch zur «digitalen Demokratie» herausgebracht. Stern sitzt auch im Sounding Board, das Zürich Feedback zu seiner Smart-City-Strategie geben soll.
Die neuen Technologien, sagt Stern, würden sich fundamental auf die Arbeitsweise des Staats selbst auswirken: «Es ist nicht klar, dass die heutige Departementsstruktur auch für die digitale Leistungserbringung am Bürger die richtige Aufteilung ist.» Zentral sei, dass sich die Verwaltung am Kundennutzen orientiere, auch bei der Frage, wie sie sich selbst strukturiere. Schon um den digitalen «one stop shop» aufzubauen, müssten die Mitarbeiter über die Departementsgrenzen hinweg gut zusammenarbeiten.
[…]
Wie auch immer die Stimmbevölkerung entscheiden wird: Daniel Leupis Finanzdepartement, speziell der bei ihm angesiedelten Informatikabteilung, wird eine Pionierrolle in der weiteren Entwicklung zukommen. Doch müssen auch die andere Departemente motiviert werden, über ihre Grenzen (und Budgets) hinauszudenken, was schwierig werden dürfte. Umso wichtiger ist es, dass sich die neun Stadträte einig sind und in ihren jeweiligen Departementen die Richtung vorgeben. Dass mit Leupi, Andreas Hauri und Michael Baumer drei Personen im Stadtrat sitzen, die sich unter dem Banner «Digitalisierung» in den Wahlkampf geworfen haben, sollte die Sache eigentlich vereinfachen. Von Hauri wurde gar die Idee eines «Digitalisierungsministers» aufgebracht.
Auch im Stadtparlament kommt das Überthema vermehrt auf die Traktandenliste. Der SP-Gemeinderat Jean-Daniel Strub verfolgt die Arbeit von Maximilian Stern und dem Staatslabor seit längerem. Zurzeit stellt er eine informelle, parteiübergreifende Gruppierung zusammen, die mehr Innovation im politischen Prozess ermöglichen will. Gerade die Kommunalpolitik sei ein guter Ort, um neue Instrumente zu erproben, findet Strub. Er denkt zum Beispiel an neue Formen der Partizipation, sei es in der Stadt- oder Quartierentwicklung. Bei grösseren Bauprojekten etwa soll die Nachbarschaft besser eingebunden werden; digitale Tools könnten hierbei helfen. Einen entsprechenden Vorstoss von Strubs Fraktionskollegin Christine Seidler hat das Parlament kürzlich überwiesen.
Bürgernäher politisieren
Einen konkreten Vorschlag hat im Parlament vor kurzem die GLP gemacht: Mittels neuer Formen der Partizipation soll geprüft werden, ob der Raum unter der Hardbrücke im Kreis 5 in der Sommerzeit zu einer Flaniermeile umfunktioniert werden könnte. Die Quartierbevölkerung und die anliegenden Unternehmen sollen sich dazu äussern. Strub hält solche Initiativen für sinnvoll – und er geht noch einen Schritt weiter. Mittels sogenannter «Bürgerhaushalte» oder «Participatory Budgeting» sollen Quartiere in Zukunft selber entscheiden können, wo in der Nachbarschaft sie Handlungsbedarf sehen und wo sie Gelder sprechen wollen. Über das Budget – etwa für einen neuen Spielplatz – könnten die teilnehmenden Quartierbewohner eigenständig verfügen. Einem entsprechenden Vorstoss hat das Parlament vor kurzem zugestimmt. Ziel sei, dass auch «unterprivilegierte Gruppen» an einem Planungsprozess teilhaben könnten – zum Beispiel Ausländer, denen die Mitsprache über den demokratischen Weg bis heute verwehrt bleibe.
«Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, aber eben nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch im politischen und sozialen.» – Jean-Daniel Strub
Noch in Diskussion ist die Schaffung eines «Innovation Fellowship»-Programms: Jedes Jahr sollen zwei Spezialisten aus den Bereichen IT, Design oder Innovation in einer Querschnittsfunktion der Verwaltung eingebunden werden. Die Fellows würden dabei aus der Privatwirtschaft rekrutiert. Damit soll gemäss Strub der «Know-how- und Ideentransfer» in den öffentlichen Sektor befruchtet werden. Ähnliche Programme gibt es bereits in New York oder San Francisco. Zürich könnte die Pionierrolle im deutschsprachigen Raum übernehmen, sagt Jean-Daniel Strub. Für ihn ist klar: «Die Digitalisierung bietet enorme Chancen, aber eben nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch im politischen und sozialen.»
Mit der direkten Demokratie seien die Prozesse in der Schweiz zwar «bürgernäher» als in anderen Staaten. Trotzdem könne man an der Urne zu Sachgeschäften am Ende nur Ja oder Nein sagen. Dank neuen Beteiligungsformen, wie Stern und er sie vorschlagen, könnten wichtige Entscheide breiter abgestützt werden. Auch dies soll dabei helfen, Zürich ein Stück «smarter» zu machen. Die digitale Umkremplung der bestehenden Strukturen hat erst begonnen.