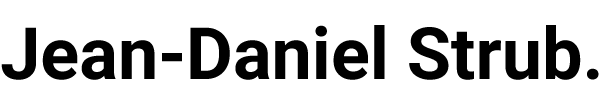Drei Wochen sind zu wenig
Der Stadtrat will nur drei Wochen Vaterschaftsurlaub gewähren. Das ist gleichstellungs- und gesellschaftspolitisch ungenügend und ein schlechtes Signal zu einem noch schlechteren Zeitpunkt. Denn die Stadtzürcher Lösung ist derzeit auch national von Bedeutung.
Jean-Daniel Strub und Min Li Marti
Kürzlich war zu lesen, dass Novartis künftig ihren männlichen Angestellten einen bezahlten Vaterschaftsurlaub von 70 Tagen gewährt. Das sind 14 Wochen, also gleich viel Zeit, wie sie Müttern von Gesetzes wegen zusteht. Der Pharmariese setzt sich damit schweizweit an die Spitze. Vor Unternehmen wie Google (60 Tage), Johnson&Johnson (40 Tage) oder Ikea und Microsoft (30 Tage), aber auch vor allen Kantonen und Städten, die ihrem Personal maximal 20 Tage gewähren.
Der Beweggrund für diese Verzehnfachung des Vaterschaftsurlaubs auf einen Schlag ist bei Novartis klar: Es geht um die Attraktivität als Arbeitgeber. Um gute Mitarbeitende anziehen und halten zu können, sind Faktoren wie der Vaterschaftsurlaub heute zunehmend wichtig. Genau gleich klingt es bei anderen Unternehmen, die erfreulicherweise in immer grösserer Zahl den Anspruch auf Vaterschaftsurlaub für ihre Mitarbeitenden erhöhen. Dies in eklatantem Gegensatz zum Ständerat, der als Gegenvorschlag zur eidgenössischen Initiative «Vaterschaftsurlaub jetzt» knausrige zwei Wochen für alle Väter in der Schweiz vorschlägt.
Keine gute Falle
Leider macht in dieser Debatte aktuell auch die Stadt Zürich keine gute Falle. Im Januar 2015 haben wir im Gemeinderat eine Motion eingereicht, die unter anderem forderte, dass der Vaterschaftsurlaub für städtische Angestellte – nur darauf kann der Gemeinderat Einfluss nehmen – von heute zwei auf künftig vier Wochen verlängert werden soll. Der Vorstoss wurde unter den damaligen Mehrheitsverhältnissen in der weniger griffigen Form eines Postulats überwiesen. Im Dezember 2018 schickte der Stadtrat mit Beschluss 1043/2018 nun seinen Umsetzungsvorschlag in die bis Freitag dauernde Vernehmlassung bei den Personalverbänden. Und diese Umsetzung sieht lediglich drei Wochen Vaterschaftsurlaub vor. Das ist klar ungenügend!
Von einer fortschrittlichen Stadt wie Zürich ist zu erwarten, dass sie bei diesem zentralen gesellschaftspolitischen Thema den Anspruch hat, progressive Triebfeder zu sein. Es ist vielfach nachgewiesen, dass die ersten Wochen entscheidend sind dafür, dass Väter echte, gleichgestellte Erziehungsverantwortung übernehmen, die auch längerfristig erhalten bleibt (etwa indem sie ihr Arbeitspensum zugunsten der Familie reduzieren). Das setzt einen Vaterschaftsurlaub von genügender Länge voraus. Wenn Väter Haus- und Betreuungsarbeit übernehmen, ermöglicht dies den Müttern, weiterhin in der Erwerbstätigkeit zu bleiben. Damit reduzieren sie ihr Armutsrisiko im Alter und bei einer Trennung massiv. Heute werden Mütter im Arbeitsmarkt regelrecht bestraft (vergleiche P.S. vom 1. März 2019): Die Löhne zwischen Müttern und Vätern gehen nach der Geburt des ersten Kindes massiv auseinander. Doch nicht nur dies. Mütter werden leider nur allzu oft nach dem Mutterschaftsurlaub entlassen, sie werden weniger zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und ihnen wird weniger zugetraut. Regelmässige, gleichgestellte väterliche Präsenz in der Familie fördert zudem nachgewiesenermassen die Entwicklung und die Gesundheit aller Beteiligten, Väter inklusive.
Stadt Zürich hinkt hinterher
Auch die Stadt Zürich muss sich im Kontext des Fachkräftemangels als attraktive Arbeitgeberin positionieren. Vor diesem Hintergrund ist es umso unverständlicher, weshalb sich Zürich mit den vorgeschlagenen drei Wochen ohne Not hinter anderen Städten wie Bern, Genf, Neuenburg und sogar Bellinzona und Biel einordnen will, die jeweils vier Wochen gewähren.
Zumal die Kosten für eine zusätzliche Woche von der Stadt mit gerade mal 300 000 Franken jährlich veranschlagt werden. Natürlich befinden sich auch weniger finanzkräftige KMU im Wettbewerb um die begehrten Arbeitskräfte. Das ist aber kein Argument gegen eine gesellschafts- und gleichstellungspolitisch einigermassen fortschrittliche Regelung, wie sie der Stadt Zürich gut anstünde. Sondern es ist ein Argument für eine Finanzierung über die Erwerbsersatzordnung, wie sie die eidgenössische Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub vorsieht.
Nur ein erster Schritt
Vier Wochen Vaterschaftsurlaub sind allerdings nur ein erster, wenn auch wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sie können in progressiver Perspektive kein Ziel an sich darstellen.
Denn letztendlich kann nur eine echte Elternzeit mit gleichem Anspruch für beide Elternteile dem gravierenden gesellschaftlichen Malaise Abhilfe schaffen, das heute das Familienland Schweiz auszeichnet: Dass nämlich die besten Strukturen nichts nützen, wenn nicht in der ersten Zeit, die Familien als Familien verbringen, eine partnerschaftliche Aufteilung der familiären Aufgaben wirkungsvoll gefördert wird. Das gelingt in letzter Konsequenz nur mit einer echten Elternzeit. Darum fordert auch die bald zu lancierende Initiative der SP Kanton Zürich, die den internen Ideenwettbewerb klar für sich entscheiden konnte, eine paritätische Elternzeit von je 18 Wochen für Väter und Mütter.
Solange eine Elternzeit aber Wunschdenken bleibt, sind vier Wochen Vaterschaftsurlaub das absolute Minimum. Sollte der Gegenvorschlag zur eidgenössischen Initiative bei zwei Wochen bleiben, ist zu befürchten, dass sich ein gleichstellungspolitisch nahezu wirkungsloser Standard etabliert, an dem sich dann auch die Unternehmen orientieren, statt von Vorbildern wie Novartis zu Lösungen auf der Höhe der Zeit motiviert zu werden. Denn warum mehr anbieten, wenn der Gesetzgeber nur zwei Wochen als wünschenswerte Länge festgelegt hat? Gerade angesichts dieses Szenarios ist von progressiven Städten das gegenteilige Signal vonnöten. Weil es gleichstellungspolitisch das Minimum ist, und weil es realpolitisch einen wichtigen Massstab setzt.
Umso mehr steht zu hoffen, dass der Stadtrat nach der Vernehmlassung auf vier Wochen einschwenkt. Ansonsten ist es am Gemeinderat, diese Korrektur vorzunehmen. Das wird dann auch zum Test für die Grünliberalen, die derzeit geradezu aggressiv mit dem Attribut «fortschrittlich» werben: Sie haben vor vier Jahren die Überweisung des Anliegens als Motion verweigert. Und sind so mitverantwortlich dafür, dass dem Stadtrat kein verbindlicher Auftrag für die progressivere Lösung mit vier Wochen erteilt wurde.